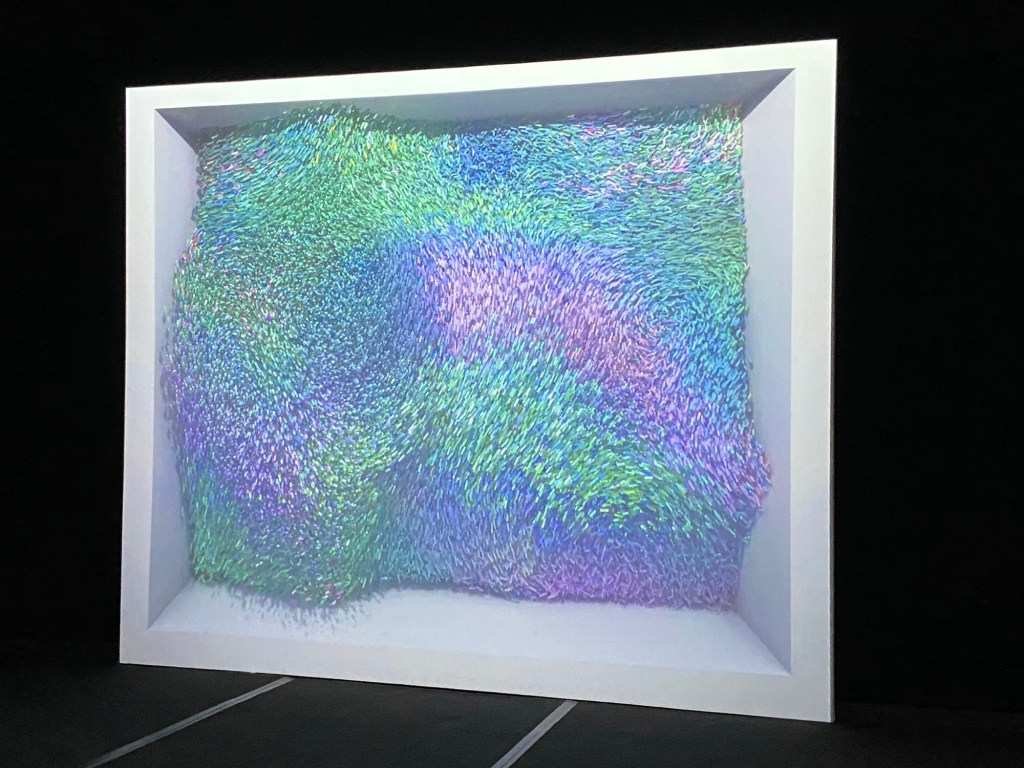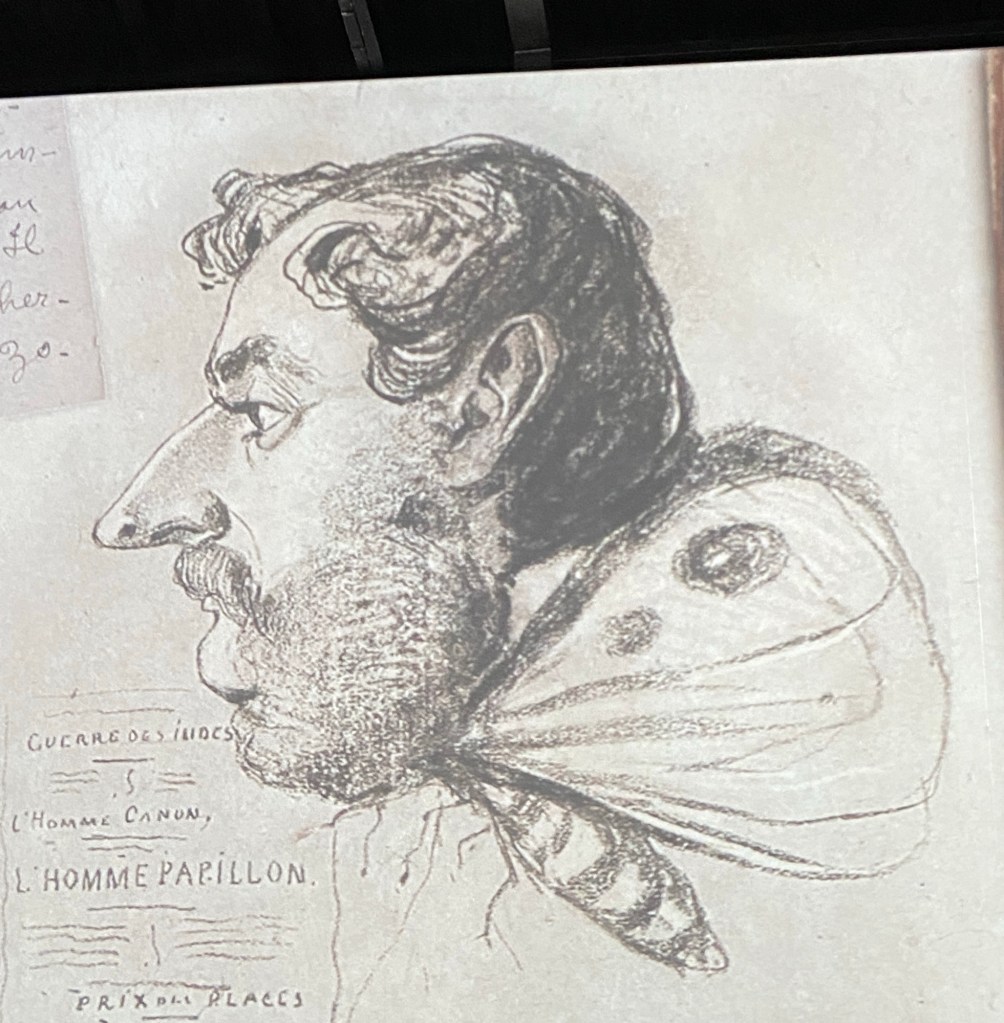Durch eine Diskussion auf Mastodon habe ich mich heute wieder an eine Theorie erinnert, die gerade in der deutschen Literaturszene (und ich verwende „Literatur“ hier bewusst weitgefasst) sehr beliebt und weitverbreitet ist:
Wenn ein Buch kommerziell erfolgreich ist, muss es Murks sein.
Da kann gar nichts Gutes drin stecken.
Und garantiert hat die schreibende Person diesen Schund nicht aus Überzeugung verfasst, sondern mit dem Hintergedanken des „Cash Grabs“ – ohne Gewissen viel Geld kassieren und das Produkt dem Markt überlassen.
Wenn ich mit Autor*innen aus anderen Kulturkreisen kommuniziere, begegnet mir dieser Gedanke seltener. Da werden kommerziell erfolgreiche Bücher eher gehyped und analysiert: Was lieben die Leser*innen an diesem Buch? Ist es inhaltlich gut oder war es vor allem das Marketing? Was hat die schreibende Person getan, um diesen Erfolg zu manifestieren? Wie hat das Buch seine Zielgruppe gefunden?
In anderen Ländern, bilde ich mir ein herauszuhören, ist kommerzieller Erfolg durch Kunst wesentlich weniger verpönt als in Deutschland.
In Deutschland kannst du eigentlich nur Künstler oder erfolgreich sein.
Dein Buch wurde in der Woche nach Veröffentlichung tausendmal gekauft? Du Betrüger*in! Warum hasst du die Kunst so sehr???
Ja gut, ich übertreibe. Aber irgendwie scheint in den Köpfen vieler Schreibender diese Idee festzuhängen, dass „gute Literatur“ etwas ist, das keinen kommerziellen Erfolg hat. Und das zieht einige problematische gedankliche Rattenschwänze nach sich.
Etwa die Annahme, dass die breite Masse keine gute Kunst erkennen könne, weil das alles ungebildete, grobschlächtige Banausen sind. Klar, das Dschungelcamp ist immer noch erschreckend erfolgreich, aber manche Leute können Trash und Entertainment und Kunst parallel genießen. Schließlich haben wir alle nicht nur eine Grundeinstellung. (Ich mag Theodor Storm und Schlefaz, verklagt mich.)
Oder die Annahme, dass Geld etwas Schlechtes sei, denn es gilt als mit der „wahren Kunst“ unvereinbar. Dabei kann ich mir wenig elenderes vorstellen, als unter prekären Umständen in kompletter Unsicherheit Kunst zu schaffen. Deswegen habe ich halt einen Brotjob (eigentlich ist es sogar ein Kuchenjob, ich lebe sehr angenehm), so kann ich mich beim Schreiben auf den Spaß-Aspekt konzentrieren.
Bei „guter Literatur“ gibt es dann übrigens noch Abstufungen, aber das nur als fixer Exkurs, weil ich mich nicht kurz fassen kann. Wenn Leute sich über mehrere Werke an ähnlichen Themen abarbeiten, ist das keine Kunst, sondern eine Masche. Wenn Leute Themen bearbeiten, die marginalisierte Gruppen betreffen, ist das eine Masche für die Quote (denk nur an das „Frauengedöns“). An der Spitze der „guten Literatur“ stehen vergeistigte privilegierte Autoren, die das Banale ins Philosophische erheben. Die wollen nicht unterhalten, sondern … ich weiß nicht, aber irgendwer soll den Driss dennoch lesen? Keine Ahnung, ich sitz hier nur und schreibe.
Anyway.
Insgeheim, denke ich, ist die Aussage „Meine Bücher sind eben zu originell/gut/literarisch anspruchsvoll/…, um kommerziell erfolgreich zu sein!“ auch eine Art von Selbstschutz. Die meisten von uns schreiben nicht so gut, wie sie gerne wollen. Viele scheitern, wenn sie großartige Ideen in großartige Bücher (Serien, Videospiele) verwandeln wollen. Irgendwo hakt es doch immer. Und wenn das Buch noch so toll ist, müssen wir uns danach mit Marketing auseinandersetzen, das ist wieder ein anderes Glücksferkel, von dem viele keine Ahnung haben – ich ja auch nicht. (Apropos, kauft meine Bücher!) Ich könnte mir also einreden, dass „Andrea die Lüsterne“ nur deswegen keinen Bestseller-Sticker hat, weil ich eben ZU GUT bin. ZU KREATIV. Ein ZU GENIALES literarisches Wunderkind. Oder das Buch ist eben gut und lustig mit Schwächen und einer eher kleinen Leserschaft, weil nicht jeder auf sexarmen Tentakelhumor steht.
(Ich prangere das übrigens an.)
Eigentlich möchten Leute, die so etwas sagen, den Spagat schaffen, ein einzigartiges, kauziges Originalbuch zu schaffen, dass auf wundersame Weise und ohne Markt- oder -Marketingkenntnis ein kommerzielles Meisterwerk wird. Wär mir ja auch ganz lieb. Das fällt aber in die Kategorie: „Ich will Prinzessin werden!“-Wunschdenken.
Eigentlich wünsche ich mir in erster Linie eine Welt, in der alle Leute genau die Kunst machen können, die sie machen wollen, ohne materielle Ängste im Rücken. Und dass diese Kunst dann genau die Leute findet, die sie brauchen.
Wahrscheinlich ist Prinzessin-Werden einfacher. ^^